Teil 1: Vulkane, Beisbol, Chickenbusse, Toña, Karibik & Pazifik – Amor a Nicaragua
Buga: 10.06.2017























































































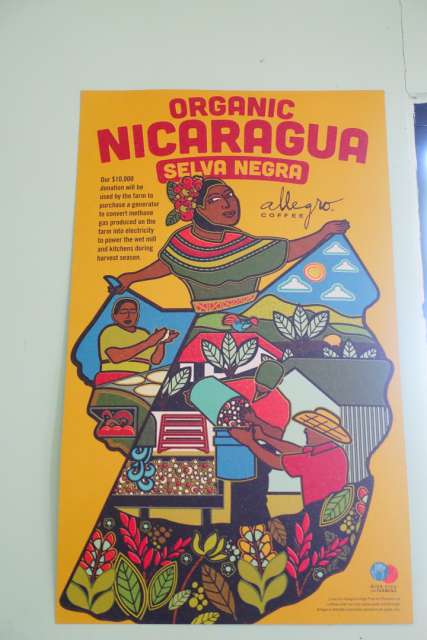































Biyan kuɗi zuwa Newsletter
Der Abschied aus Südamerika fiel uns sehr schwer, aber wir waren auch gespannt auf Mittelamerika, vor allem weil die Länder hier so klein und dementsprechend „schneller“ zu bereisen sind. Nachdem wir ja ursprünglich Costa Rica auf dem Reiseplan hatten, uns aber von vielen Reisenden davon abgeraten wurde, weil wohl alles schrecklich „veramerikanisiert“ und teuer ist, entschieden wir uns für das Nachbarland Nicaragua. Der Flug nach Managua verging auch wie im Flug, trotz südamerikanischem Pendant eines Herren-Kegelclub-Mallorca-Trips an Bord! Der Hauptstadt wollten wir aber erstmal keinen Besuch abstatten, stattdessen entschieden wir uns für das schöne Städtchen Masaya, wohl die drittgrößte Stadt des Landes, in dem es sehr entspannt und typisch nicaraguanisch zu ging. Der Ortskern mit seinen vielen Kirchen, Handwerksständen, Hängematten- und Schaukelstuhlfabriken, Pferdekutschen und bunten Parks nahm uns sofort für sich ein und auch die Nicaraguaner bzw. Nicaragüensen machten einen sehr lieben und lustigen Eindruck auf uns. Ein Nica, wie sie sich selbst nennen, trägt meist lange Hosen, was uns angesichts der höllischen Temperaturen weit jenseits der 32 Grad als nicht nachvollziehbare Form der Selbstgeißelung erscheint, aber es gehört hier einfach zum guten Ton, lange Hosen zu tragen. Man könnte vermuten, dass die Einheimischen einfach an die Temperaturen gewöhnt sind, aber sie schwitzen und schmelzen genauso wie wir und beklagen sich über die Hitze.
Masaya ist das Mekka für Handwerks- und Souvenirarbeiten und so starteten wir den Tag mit einem Bummel durch den Markt, den auch die Einheimischen besuchen, um somit einen Vergleich für den extra für die Touristen eingerichteten Markt zu haben. Unter den Wellblechdächern staute sich die Hitze, so dass aus dem gemütlichen Marktbummel eher ein schweißtreibender Marsch wurde. Neben den schönen Taschen, Geldbeuteln und Souvenirs haben es mir vor allem die unzähligen Piñatas angetan, die hier nur darauf warteten, bei der nächsten Party vermöbelt zu werden. Es war zwar mein Geburtstag, aber die erhältlichen Minipiñatas und die Bonbonfüllungen trafen nicht so recht meinen Geschmack. Anstatt Piñatas zu verhauen, wollten wir abends nämlich den sehr aktiven Masaya-Vulkan besuchen, um endlich mal Lava live zu sehen. Zu Fuß darf man nicht auf den Masaya, weil man im Falle eines Ausbruchs nicht schnell genug wieder runter kommen würde. Also nahmen wir ein Taxi, was mir angesichts der auch nachts noch schweißtreibenden Temperaturen sehr entgegenkam. Der abendliche Vulkanbesuch wird streng geregelt, es dürfen immer nur eine handvoll Leute gleichzeitig oben sein, weswegen es am Eingang zu langen Autostaus kommt. Als wir dann endlich hoch durften, gab unser Taxifahrer aber alles und düste mit seiner kleinen Kiste im ersten Gang mit 80 km/h zum Gipfel, wo wir dann als Erste aussteigen und uns voll und ganz dem Lavaspektakel hingeben konnten. Das Brodeln, Zischen und Ploppen der 1100 Grad heißen Lavablasen war einfach gigantisch! Der Masaya ist einer der aktivsten Vulkane im Land und die indigene Urbevölkerung sah in ihm die Wohnstätte von Göttern, die in ihrer Wut den Vulkan ausbrechen ließen. Um sie zu besänftigen wurden häufig Menschen geopfert. Viele Opfer waren Kinder und Jungfrauen. Ein Brauch, der auch in jüngerer Vergangenheit wieder aufgenommen wurde. Zu Zeiten der nicaraguanischen Revolution wurden Gefangene in dem über 300 Meter tiefen Krater „entsorgt“.
Danach gönnten wir uns noch ein leckeres Abendessen am Hautplatz, wo ich vollkommen unerwartet nochmals mein Lieblingsessen aus Perú, das rohe Fischgericht Ceviche, genießen konnte. Nebenbei wurden wir noch Zeugen einer abenteuerlichen Faultier-Rettungsaktion. Das parkansässige Faultier war von seinem Lieblingsbaum geplumpst und hatte sich dann auf dem Platz „verlaufen“. Gefolgt von Kindergeschrei erfüllte der Dorfsheriff aber pflichtbewusst seine Aufgabe, zu der es in Nicaragua anscheinend auch gehört, verwirrte Faultiere wieder nach Hause zu bringen. Also wurde das graue Fellknäul an seinem Allerwertesten wieder auf seinen Baum geschoben.
Ansonsten erkundeten wir in Masaya noch den Tourimarkt, die Uferpromenade an der Laguna und ein altes Castello, das in der Zeit der Diktatur als Foltergefängnis genutzt wurde. In dem Tunnelsystem, das ein bisschen an das verrückte Labyrinth erinnert, leben tausende Fledermäuschen, die sich für uns leider nicht in Graf Dracula verwandelten.
Leider habe ich beim Abendessen etwas Vergammeltes erwischt, was mich dann einen ganzen Tag außer Gefecht setzte. Die Einheimischen wollten mir schon Dengue-Fieber aufschwatzen, das wars dann zum Glück aber nicht.
Die Busfahrt zum nächsten Stopp im „Hühnerbus“, hier Chickenbus genannt, weil die Passanten wie die Hühner in die alten Schulbusse gestopft werden, wurde mir jedoch erspart, da Tömmi einen günstigen Taxipreis nach Granada aushandelte!
In der Kolonialstadt-Perle Granada hatten wir ein wunderschönes Hotel mit Pool und Klimaanlage, von der wir nie gedacht hätten, dass sie der wichtigste Gegenstand im Zimmer werden würde. Granada begrüßte uns nicht nur mit zauberhaften bunten Kolonialgebäuden, sondern auch mit unmenschlicher Hitze, ich denke gefühlte 40 Grad sind nicht übertrieben. Deshalb hielten sich die Tourimassen tagsüber auch in Grenzen, die beiden wunderschönen Kathedralen besichtigten wir ganz allein. Die vorwiegend amerikanischen Touris ließen sich eher mit den allgegenwärtigen Pferdekutschen durch die Stadt ziehen, die klepprigen Pferdchen taten uns sehr leid. Auch beim Kanuausflug durch die Isletta-Inseln waren wir mit unserem Guide allein unterwegs. Die Islettas sind 365 Vulkaninseln im Lago Nicaragua, die teils mit Luxushotels oder Privatvillen bebaut sind oder zum Verkauf angeboten werden, ab 100.000 $ wird man zum Inselbesitzer, wer Interesse an einer Inselgemeinschaft und viel Geld hat, meldet sich bitte bei mir 😊 Die Kayaktour war sehr erfrischend, für Tömmi ganz besonders, weil er sich dank zu übermütigem in die Kurve Lehnens kopfüber im Wasser wiederfand. An Tömmis Geburtstag ließen wir es dann ganz ruhig angehen, mit Kokosnuss-Cocktail an der Uferpromenade und leckerer Pasta beim besten Italiener der Stadt.
Abends kriechen dann aber auch die schwitzenden Amis aus ihren Hotelburgen und gehen essen, weswegen es kaum authentische, nicaraguanische Restaurants in der Innenstadt gibt. Allgemein wird man in Granada fast ausschließlich auf Englisch angesprochen oder sogar recht unhöflich auf Spanisch beleidigt, weil die Leute es nicht gewohnt sind, dass Touris Spanisch sprechen. Des Weiteren wurden uns die unmöglichsten Lügengeschichten aufgetischt, um an unser Geld zu kommen, was uns wirklich auf die Nerven ging.
Außer hübschen Fotomotiven konnte uns Grenada nicht viel bieten, weswegen wir noch die Dörfchen in der Umgebung erkunden wollten, von denen wir uns etwas mehr Authentizität erwarteten. Also ab im Chickenbus in die weißen Dörfer, die Pueblos Blancos.
Kleiner Exkurs zum Thema
„Chickenbus“: „Ist das jetzt der Marktplatz oder die Bushaltestelle?“ Diese
Frage stellen sich wohl die meisten, die zum ersten Mal in Nicaragua Bus fahren
wollen. Während in Europa zumeist ein paar Minuten gelangweilt im
Bushaltestellenhäuschen gewartet wird, bis der Bus dann meist auch pünktlich
eintrifft, herrscht in Nicaragua fast schon Volksfeststimmung an den
Busstationen. Von überall her strömen die Menschen, auf dem Kopf werden riesige
Strohkörbe gefüllt mit Quesadillas, in Bananeblätter eingewickeltes Yagurón, Obst,
Keksen und anderen Köstlichkeiten balanciert. Andere schleppen schwere Külboxen
mit Gaseoas, Softdrinks, mit sich, um den Wartenden in der drückenden Hitze
etwas Kühlung zu verschaffen. Die Busse füllen sich schnell und bald hat sich
die erlaubte Passagierzahl verdreifacht. Auf einigen Fahrscheinen, die es
manchmal schon vorab zu kaufen gibt, lesen ich anstatt einer Sitzplatznummer
ein „P“, das wie sich herausstellt für Plástico, also Plastikhocker steht, die
zusätzlich zu den normalen Sitzbänken noch in den Gang gestellt werden, um
Sitzplätze zu schaffen. Auch der Markt wird kurz vor Abfahrt in den Bus verlagert:
Verkäuferinnen quetschen sich durch die besetzten Gänge und bieten von der
Grußkarte für den Muttertag bis über in Plastiktüten abgefüllte selbstgebraute
Refrescas, Erfrischungsgetränke, alles an, was man auf einer Busfahrt so
braucht. Wir hoffen indessen, dass unser Gepäck auf dem Dach auch gut
festgezurrt wurde, die Straßen hier haben es nämlich in sich.
Bei den Bussen handelt es sich um alte, ausgemusterte, nordamerikanische Schulbusse vom Typ „Bluebird“, die technisch nicht nur an den harten mittelamerikanischen Straßenalltag, sondern auch farblich an das bunte Flair hierzulande angepasst wurden. Dazu kommen liebevolle Details – seien es metallene Embleme nackter Frauen auf dem Kühlergrill oder eingebaute Soundsysteme, mit denen sich ein ganzes Dorf beschallen lässt. Da die Busse für die Beförderung von Schulkindern gebaut wurden, wurden auch die Sitze nur für Kinderbeinchen ausgelegt. Daran können wir zwei Schlümpfe uns ja noch gewöhnen, aber wenn dann noch die für zwei Kinder ausgelegten Bänke mit drei Erwachsenen bestückt werden, wird es auch für uns sehr ungemütlich. Vor allem die Wartezeiten, bis der Bus endlich losfährt, sind für mich fast unerträglich. Bei 40 Grad ohne Windchen zwischen dicken Nicaraguanerinnen eingequetscht auf Kunstledersitzen in seinem eigenen Schwitzsaft garen, ist nicht unbedingt meine schönste Reiseerfahrung. Aber Chickenbusfahren ist einfach ein Erlebnis, das zu einer Mittelamerikareise dazu gehört.
In Catarina angekommen hatten wir einen wundervollen Panoramablick auf die Laguna Masaya und die Vulkane Masaya sowie Mombacho. Die Laguna sah sehr einladend aus, also heuerten wir ein Mototaxi an, dass uns für einen Wucherpreis runter an die Lagune an einen schönen Sandstrand brachte. Nach einer erfrischenden Abkühlung holte uns das Mototaxi auch wieder ab, jedoch schafften wir es aufgrund eines Achsbruchs nur mit Umsteigen in ein Taxi bis zur Bushaltestelle.
Der Abschied aus Granada fiel uns nicht schwer und wir freuten uns schon wie Jim Knopf auf die Insel mit zwei Bergen namens Ometepe. Die zwei perfekt geformten Berge sind Vulkane und das Inselchen liegt inmitten des Nicaraguasees. Von San Jorge aus gings mit einem Schiff rüber nach Ometepe, dort hatten wir uns im von Touris nur wenig frequentierten Altagrazia bei einer sehr netten Familie einquartiert. Unser Zimmer war sehr einfach eingerichtet und das Gemeinschaftsklo lag unter freiem Himmel, aber wir hatten ja so viele Pläne für Ometepe, dass uns das nicht weiter störte. Wir wollten einen der Vulkane besteigen, im Ojo de Agua planschen, ich wollte ein Urmel-aus-dem-Eis-Ei finden und mich vollkommen dem Inselleben hingeben. Nur leider haben wir die Rechnung nicht mit den kontaminierten Lebensmitteln gemacht, die ungekühlt vor sich hin gammeln, bevor sie den untrainierten Tourimägen zugeführt werden. Diesmal erwischte es Tömmi, und zwar richtig schlimm. Unsere kompletten 4 Tage auf Ometepe vegetierte er in dem schäbigen Zimmerchen vor sich hin und versuchte rechtzeitig die Toilette zu erreichen. Unsere Gastgeber kümmerten sich aber so gut es ging um ihn, so bekam er als Kotzeimer ein ausgedientes Fußbad neben die Matratze gestellt und mir wurde aufgetragen, ganz bestimmte Medikamente in der Dorfapotheke zu kaufen. Als ich die Medis googelte, stieß ich auf deutsche Berichte aus dem Jahr 1974 😊 Aber besser als nichts. Tömmi schluckte brav die Medis und süffelte einen Elektrolyte-Drink, so dass er immerhin die Bootsfahrt zurück zum Festland einigermaßen überstand. Zurück in San Jorge ließen wir ihm noch einen Tag Regenerierungs-Zeit, bevor wir im Hühnershuttle in die Hauptstadt Managua fuhren.
Managua hat leider keinen Stadtkern, weil es mehrfach von Erdbeben komplett zerstört wurde und aufgrund recht vieler Überfälle auf Touristen hat es auch keinen guten Ruf. Vor allem wird man vor Taxifahrern gewarnt, die ihr Schindluder mit den armen Touris treiben. Wir hatten aber mal wieder Glück, unser Taxifahrer wollte uns nicht bestehlen, er war nur unter starkem Drogeneinfluss und komplett geisteskrank. Tömmi, der sich natürlich wieder ausgiebig über mögliche Gefahren in der Hauptstadt informiert hatte, sah uns schon ausgeraubt und auf einer Müllkippe ausgesetzt und war angstschweißgebadet, als wir endlich am Hostel ankamen. Wir nutzten den Zwischenstopp in Managua nur, um auf die Karibikinseln Corn Islands zu fliegen und überflüssiges Gepäck zu lagern.
Wer auf die Maisinseln fliegt, darf nur 13 Kilo mitnehmen und da wir annahmen, außer Flipflops und Badeklamotten nicht viel zu brauchen, packten wir zusammen eine Tasche, die es dann auf 16 Kilo brachte. Unsere Adam-Riese-Rechnung ging aber nicht auf, denn am Check-In-Schalter wurde stoisch darauf beharrt, dass die Gepäckstücke nicht über 13 Kilo wiegen dürfen, auch wenn wir eigentlich 26 Kilo mitnehmen dürften. Die Dame am Schalter hatte den gleichen Dickschädel wie ich, bevor die Diskussion aber ausartete, kam uns eine nette Insulanerin zur Hilfe und riet uns, einfach einen Teil des Gepäcks in eine Plastiktüte zu packen und diese dann aufzugeben. Dieser Plan ging dann auch problemlos auf und wir bekamen endlich unsere Bordkarten ausgehändigt. Als dann mit einiger Verspätung unser kleines Propellermaschinchen endlich abhob, waren wir schon vollends in Urlaubsstimmung. Ebenso die Piloten, die ihre Sonnenblenden ausklappten, sich gemütlich zurücklehnten und ein Filmchen auf ihrem Handy ansahen. Dass unsere Ultraleichtmaschine minütlich durch Luftlöcher und Gewitterwolken taumelte und alle 9 Passagiere wie in einer Achterbahn kreischten, interessierte sie nicht. 1,5 Stunden später erblickten wir dann endlich türkisblaues Wasser und Palmen auf Big Corn Island, der größeren der beiden Maiskölbchen. Wir hatten uns für 8 Nächte bei Gianni, einem italienischen Auswanderer, in seinem Hotel Bella Vista eingemietet, das uns alle Annehmlichkeiten bot, die man in der Karibik so braucht, inklusive hausgemachter Spaghetti a la Mama. Da Tömmi sich von seiner Magen-Darm-Infektion noch vollends erholen musste und mich das Robinson-Crusoe-Fieber gepackt hatte, meldete ich mich bei einer Tauchschule an, um endlich einen Tauchschein zu machen. Mein südafrikanischer Instructor Shaun merkte recht schnell, dass Wasser mein Element ist und mich auch eine geflutete Taucherbrille oder kaputter Luftrüssel nicht aus der Ruhe bringen konnten. Also gings nach kurzer Übungsphase am Strand gleich ins Riff und ich tauchte in eine andere Welt ein. Die komplett intakten Riffs rund um die Corn Islands beheimaten viele Haie, hauptsächlich Ammen- und Riffhaie, tausende Hummer und noch mehr Fische, die ich davor noch nie gesehen hatte. Auch Rochen und Schildis ziehen hier ihre Bahnen. Zudem gab es Korallenformationen, wie ich sie mir niemals hätte erträumen können. Ich war also vollends im Tauchfieber, musste aber zwischen den Tauchgängen noch die nervige Theorie pauken, was in der Hängematte unter Palmen aber auch recht erträglich war. Tömmis Gesundheit war auch wieder vollends hergestellt und so führten wir ein recht entspanntes Lotterleben mit Schnorcheln, Plantschen und leckerem kreolischem Essen. Es klappte sogar noch mit einem Treffen mit Tina2 von der Galapagoscrew, die durch Zufall auch gerade hier Station machte.
Auf den Corn Islands wird eigentlich Créol und Miskito gesprochen, die Insulaner beherrschen aber auch Englisch und Spanisch, mit Inselslang. Rund um die Uhr schallt Reggae und Countrymusic aus den Boxen, ein Stilmix, den es vermutlich nur hier gibt und die Lieblingsbeschäftigung der Einheimischen ist es, neben „Beisbol“ auf kleinen Fernsehern zu schauen, eine Badepause im türkisblauen Wasser einzulegen, oder eben gleich Beisbol im Wasser oder am Strand zu spielen. Ganz Nicaragua ist baseballverrückt, aber hier auf den Maisinseln scheint es für Viele der einzige Freizeitvertreib zu sein. Da momentan aufgrund der Regenzeit Nebensaison ist, und auch noch Schonzeit für den Hummerfang, gibt es auch wirklich nicht viel zu tun. Ein paar Männer hämmern die zahlreichen Hummerkästen wieder zusammen, die ab Juli dann tausenden von Lobstern zum Verhängnis werden. Die vielen Hummerfrachter, die während der Schonzeit in den Buchten vor sich hin dümpeln und den Kindern als Sprungbretter für Arschbomben dienen, fahren in der Fangsaison mit 5000 Fangkäfigen bestückt die Riffe ab. Da kommen schon so einige Kilos an Hummer zusammen. Der Großteil geht dann direkt nach Japan und in die USA.
Ich schließe Big Corn schon nach wenigen Tagen in mein Herz, die Menschen sind so unglaublich nett, die Taxifahrer kennen schon bald meinen Namen und machen auf dem Weg zur Tauchschule noch eine kleine Inselrundfahrt mit mir. Mädels werden hier wieder „Sissi“ genannt, was mich an meine Zeit in Südafrika erinnert und überhaupt gefallen mir die afrikanische Gelassenheit, der spezielle Dialekt und die Gastfreundschaft der Menschen hier besonders. Am Festland sind die Menschen zwar auch sehr freundlich, aber zu mir meist nur die Männer. Nicaragüense Frauen raunen einen oft nur an oder würdigen einen, wenn überhaupt, nur mit sehr abschätzigem Blick, während die Männer einen fast hofieren. Daher kommt wohl auch die Abneigung vieler einheimischer Frauen den Touristenmädels gegenüber, wie mir Franzi berichtete, die hier mehrere Jahre gelebt hat und im Flieger nach Big Corn neben mir saß. Es kommt wohl häufig vor, dass sich vor allem Frauen hier im Urlaub auf Beziehungen mit Nicaraguanern einlassen, die dafür dann eben oft ihre einheimischen Mädels betrügen.
Auf Big Corn war davon jedenfalls nichts zu spüren, wir fühlten uns total im Karibikparadies angekommen und wohl wie Nemo in seiner Anemone.
Nach 4 Tagen hatte ich meinen Padi Open Water Diver dann in der Tasche und war bereit für die nächste Tauchschule auf Little Corn Island. Zwischen Big und Little Corn pendelt ein Cabrio-Panga, eigentlich nur eine bessere Nussschale, in das ungefähr 30 Personen gequetscht werden. Am Morgen unserer Überfahrt schüttete es aus Kübeln und auch der Wellengang war beachtlich. Als Regenschutz wurde eine schimmelige Plastikplane über die Köpfe der Passagiere gespannt, die diejenigen, die am Rand saßen, festkrallen mussten - bequem geht definitiv anders. Die Einheimischen im Panga bekreuzigten sich bei jeder Welle, in deren Täler wir wirklich wie eine Nussschale zu stürzen schienen. Mir kam die Horrorgeschichte wieder in den Sinn, die mir die Mitarbeiter der Tauschule erzählt hatten: Vor einigen Monaten ist genau so ein Panga mit 35 Touristen an Bord gesunken und nur wenige haben überlebt, schuld waren damals wohl auch die zu hohen Wellen.
40 Minuten später hatten wir aber die kleine Maisinsel wohlbehalten erreicht und wurden von mehreren verspulten Typen für freie Cabañas angeworben. Wir wollten auf die Ostseite der Insel, da es dort etwas ruhiger und gechillter zugehen sollte. Ein Rastafari mit „Grace´s Cool Spot“- Schild schien uns ganz nett und er bot uns eine Hütte am Meer für 25$ an, also ab durch den Dschungel, dem barfüßigen Rastafari hinterher durch zermatschte Mangos auf noch vermatschterem Dschungelboden. Bei Grace bekamen wir dann auch eine einfache aber zufriedenstellende Hütte, ich beharrte auf direkte Meerlage, was sich noch als Fehler herausstellen sollte. Inzwischen schüttete es wieder und so merkten wir gleich, an wie vielen Stellen unsere Cabaña undicht war 😉 Das Wetter besserte sich die folgenden 3 Tage leider nicht, ein Tiefdruckgebiet pflügte über die Insel hinweg und brachte das Meer direkt vor unserer Hütte ganz schön in Wallung. Regemäßig wurde unsere Terrasse geflutet und die Wellen klatschten hoch bis übers Fenster. Nachts war es immer besonders übel und wir befürchteten schon, jeden Moment weggespült zu werden. Genau wie die einstmals paradiesischen Strände, die aufgrund der Meeresspiegelerhöhung kaum noch sichtbar sind. Wer die Hütten für die Touris zu nah ans Wasser gebaut hat, wie in unserem Fall, wird sich demnächst ein anderes Fleckchen suchen müssen, Experten geben Little Corns Küsten keine rosigen bzw. sandigen Prognosen!
Eigentlich hätte mir das schlechte Wetter ja egal sein können, ich hatte mich ja für 5 Tauchgänge bei Dolphins Dive angemeldet. Doch schon nach dem ersten Tauchgang wollte ich sofort wieder zurück nach Big Corn. Mein Tauchguide Gerry war ein besserer Zirkusdompteur, der sich dafür rühmt, Ammenhaie wie Hunde trainiert zu haben. Die Ausrüstung ließ auch zu wünschen übrig, schon vor dem ins Wasser rollen fiel der Drehverschluss meiner Luftflasche ab, bei anderen waren die Mundstücke defekt oder die Bänder der Taucherbrillen rissen. An Land konnten wir nichts kontrollieren, da die Guides „netterweise“ schon alles aufs Boote getragen hatten. 3 von 5 Flaschen waren auch nicht komplett mit Luft gefüllt, was natürlich eine viel kürzere Tauchzeit zur Folge hatte. Unter Wasser wurde die Enttäuschung dann einigermaßen von dem fantastischen Riff wettgemacht, Dompteur Gerry ging mir aber übelst auf die Nerven. Seine zahmen Ammenhaie folgen ihm tatsächlich wie Hunde, weil er sie regelmäßig mit Lionfish füttert und diese Zutraulichkeit nahmen einige Taucher zum Anlass, die Haie zu streicheln, was meiner Meinung nach vollkommen unangemessen ist. Schlafende Rochen wurden von Gerry und seinem Dompteurstab genauso gestört wie die Schildkröten beim Fressen. Die mit Deppenzepter und GoPro bestückten Mittaucher fanden es natürlich super, wie der eben noch friedlich schlummernde Rochen hochschreckt oder der armen Schildi mit einem Stock etwas Fressbares vorgegaukelt wird. Leider konnte man sich seinen „Kunststücken“ nicht entziehen, da er so lange mit seiner Unterwasserrassel Krach machte, bis jeder seiner Tauchschützlinge zugesehen hatte. Zum Glück war bei den nächsten Tauchgängen ein nettes schwules Pärchen aus New York dabei, die sehr erfahrene Taucher sind und denen Gerry Nummern auch sehr missfielen. Die haben mich dann unter ihre Fittiche genommen und so konnten wir ein bisschen unser eigenes Ding machen. Wir wollten eigentlich noch unbedingt den „Blowing Rock“ abtauchen, welcher aber aufgrund der für die nächsten Tage sehr miesen Wetterprognose gesperrt wurde.
Das üble Wetter und die nicht meinen Erwartungen entsprechende Tauchschule schlugen sehr auf meine Stimmung und so nörgelte ich so lange herum, bis Tömmi einwilligte, in 2 Tagen wieder zurück nach Big Corn zu fahren. Ich hatte nämlich schon Kontakt zu meiner Tauchschule dort aufgenommen und dort war A) das Wetter viel besser und B) hatten sie für die nächsten Tage Tauchgänge für „Blowing Rock“ geplant.
Also wanderten wir noch ein bisschen durch die dschungelige Inselmitte von Little Corn, entdeckten noch das eine und andere schöne Plätzchen, konnten in einer halbstündigen Regenpause auch mal kurz baden gehen und genossen ein superleckeres 4 Gänge Abschiedsdinner im „Turned Turtle“.
Ich freute mich wahnsinnig, wieder zurück auf dem großen Maiskolben zu sein, doch leider erfuhren wir von unserem schon bekannten Taxifahrer, dass Gianni, unser italienischer Gastgeber, am selben Morgen nach Italien in den Urlaub abgedüst war, also mussten wir uns eine andere Unterkunft suchen. Der Taxifahrer schlug uns „Big Fish“ vor, wo es gerade noch ein perfektes Zimmer für uns gab und von wo ich sogar zur Tauchschule laufen konnte. Schon mittags begegneten wir den New Yorkern, die genauso wie wir die Flucht ergriffen haben. Wir feierten bei strahlendem Sonnenschein unsere Entscheidung und spähten schadenfroh rüber nach Little Corn, das in dicke graue Regenwolken gehüllt war 😎 Die New Yorker meldeten sich dann auch noch für den Tauchtrip zum Blowing Rock an, so dass es für uns alle etwas günstiger wurde, und ich bin trotz der 80$ sehr froh, diesen gigantischen Felsen aus der Fischperspektive gesehen zu haben. Gleich beim Abtauchen zog ein riesiger Riffhai unter mir seine Bahnen, ich war aber mit Druckausgleich und Co. so beschäftigt, dass ich den gut 3 Meter langen Burschen direkt unter mir gar nicht bemerkte und somit um ein Haar zur Hai-Rodeo-Reiterin mutiert wäre 😉 Schon im nächsten Augenblick sahen wir weitere 4 Riffhaie, eine Schule von 5 gigantischen Adlerrochen und ein paar Ammenhaie um uns herum schweben. WOW! Die nächsten 40 Minuten kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus und auch der zweite Tauchgang wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.
Abends wollten wir uns noch mit der Tauchercrew in einer sehr abgelegen Bar auf einen Sundowner treffen, da wir aber leider erst lange nach Sonnenuntergang eintrafen und die Bar schon geschlossen hatte, wollten wir uns zu Fuß auf den Weg zurück zum Strand machen. Nach einigen Metern stoppte ein Mopedfahrer neben uns, der uns nicht erlaubte, zu Fuß zurück zu laufen, da er Angst um uns Touris hatte. Er bestand darauf, uns mit seinem Moped zurück zu bringen, so wurden wir auf das Zweirad gestapelt und die lustigsten 15 Minuten Motorradfahren nahmen ihren Lauf.
Anmerkung von Tömmi: Wirklich lustig fand ich persönlich diese 15 Minuten nicht, denn nicht nur mein Sicherheitsbedürfnis litt unter dem Höllenritt. Zu dritt, ohne Helm, und in meinem Fall noch barfüßig versuchte ich mich zwischen dem Fahrer und Tina so klein wie möglich zu machen, aber die schweren Turnschuhe von Tina bohrten sich immer tiefer in meine zarten Füßchen, da wir ja nur zwei Fußstützen für 6 Füße hatten. Besonders an den „schlafenden Bullen“, die alle paar Meter unseren Rennfahrer zu einer Vollbremsung zwangen, um dann über die Hubbel zu holpern, trieb es mir die Tränen in die Augen und ich flehte, dass diese besonders perfide Foltermethode bald ein Ende findet. Dennoch war unser Fahrer ein unglaublich netter Kerl, dem es ausschließlich um unsere Sicherheit ging und nicht einmal ein kleines Dankeschöngeld annehmen wollte. Ein weiterer Beweis für die unglaublich netten Menschen auf Corn Island.
Zum Abschluss unseres Inselabenteuers machte ich noch einen Nachttauchgang, wo ich Oktopusse und jede Menge leuchtender Teilchen zu sehen bekam, surreal schön.
Weiter gehts mit Teil 2 im nächsten Eintrag
Biyan kuɗi zuwa Newsletter
Amsa

Rahoton balaguro Nicaragua

